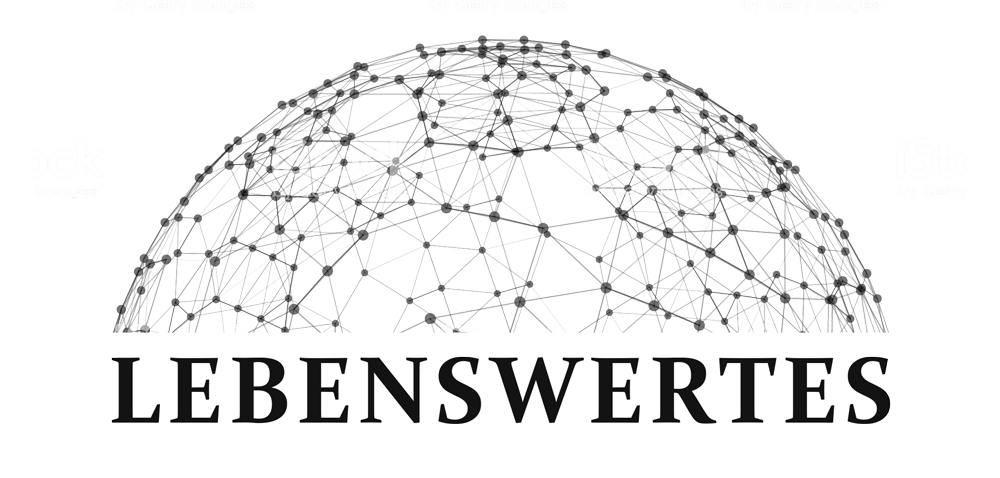Ich hatte es also tatsächlich gewagt: All-Inclusive-Urlaub am Meer! Für einen, der bis dato das rustikale Schlafsacklager, die abenteuerliche Lagerfeuerstimmung an fremden Orten und die konzeptlose Begegnung präferierte, ein Abstecher in die unbekannte und für meinen Begriff doch ziemlich spießige Welt der Pauschalurlaube. Wenigstens – so dachte ich beim Anblick des verregneten Zielflughafens selbstironisch – gehört immerhin noch eine gehörige Portion Abenteuerlust dazu, gerade im Wintermonat an einen Badeort zu verreisen! Nach diesem arbeitsreichen Jahr war mir einfach nicht nach Improvisation zumute, sondern nach Besinnung und Bestandsaufnahme, ja mehr noch; ich sehnte mich geradezu nach Tagen, prasselnden Regens oder meterhohen Schnees, um mich ruhigen Gewissens in eine flauschige Decke einpacken und anschließend auf den Grund eines spannenden Buches abtauchen zu können. Da kam mir das Angebot meines Vaters, mich mit einer Reise zu beglücken, so ich denn endlich einmal einen für seine Begriffe „richtigen“, also geregelten Urlaub in einer Hotelanlage buchen würde, natürlich sehr gelegen. Wieso auch sein Selbstbild ständig in denselben Klischees bestätigen, dachte ich, und wieso das identitätsstiftende Sammelsurium vergangener Erfahrungen, das dem Ich anhaftet nicht auch einmal mit einem anderen Raum reagieren lassen? Pauschalreise hin, Entdeckerpathos her; hier, am Abstellgleis der Welt, am verregneten Ende der Jahreszeiten, war ich trotz all meiner Ressentiments goldrichtig!
Im Hotelzimmer angekommen öffne ich den Pseudobrokat-Vorhang um einen Blick auf mein Domizil zu werfen: Flachbildschirm, Bademantel und Minibar trifft Stuckdecke, Marmorböden und Rokoko-Möbel. Ich resümiere: stillos aber für 10 Tage in Ordnung. Dafür offenbart der Blick aus dem Fenster in der Ferne den Zauber einer kalten, aufgewühlten See. Zwischen Sturmwellen, die durchs heulende Wintermeer peitschen, bahnt sich im grauen Schleier des Regens zittrig der zerfranste Leitstrahl eines Leuchtturms seinen Weg. Die verregneten Gassen sind leer, kein Mensch überquert die weitläufige Hotelanlage und dennoch ist die Welt da unten voll Leben, denn in den Bewegungen der Zypressen und Kiefern, der Wolken und den Schwingungen der von Tropfen getroffenen Pfützen verfängt sich Augenblick um Augenblick endlos Einmaligkeit. Die Welt ist heute beschäftigt genug, ich muß das Rad nicht auch noch drehen … Balsam für eine rastlose Seele.
Ich lege mich aufs Bett und betrachte auf der Leinwand meiner geschlossenen Lider die aufkommenden Bilder der langen Anreise, der letzten strapaziösen Monate. Vor ein paar Wochen schien der Gedanke an diesen Urlaub noch fast unvorstellbar und jetzt liege ich tatsächlich inmitten jener so fernen Vorstellung von einst und komme dabei nicht umhin festzustellen, daß die Fülle der zwischenzeitlich gemachten Eindrücke und Bilder verbunden mit dem Tempo des mich neblig umfließenden Wandels das Leben manchmal höchst unwirklich erscheinen läßt. Dieser ganze Gedankenraum, in dem mir die Welt entgegenkommt, gleicht einer hektisch pulsierenden Großstadt, die sich im steten Umbau befindet, in der nichts als wallende Unruhe wohnt.
Wenn meine Wahrnehmung in dieser Inflation an Eindrücken aber zwangsläufig zu substanzlosen Lichtschlieren eines amorphen Transitraums mutiert, wenn selbst das Raum-Zeit-Empfinden je nach Erlebnisdichte gestaucht oder gestreckt wahrgenommen wird, wenn also alles, was das Bewußtsein bevölkert in stetem Wandel ist und bald schon im Strudel der Zeit zerfließt, was hat dann, wenn ich gleich erneut die Lider schließe, eigentlich noch Bestand? Wie bewahre ich die Menschen, die ich so sehr liebe, vor dem Sog der Vergänglichkeit? Kurz: gibt es ewiges Sein oder enttarnt die Zeitrafferfahrt vor dem geistigen Auge den Schein der Dinge, ihren zutiefst illusorischen Charakter?
Anstatt die Denkmaschine nun weiter zu befeuern, wuchte ich mich ohne mich auf weitere Diskussionen mit mir selbst einzulassen – wer diskutiert hier eigentlich mit wem? – aus dem Bett, ziehe meinen Jogginganzug an und begebe mich zum Fitnessraum des Hotels. Ein paar Kilometer auf dem Laufband werden mein Gedankenfieber abkühlen. Das gesuchte Sportgerät steht genau vor einer großen Fensterzeile und jenseits dieser Glaswand, in der Außenanlage des Hotels, befindet sich das Freibad mit den obligatorischen Liegestühlen, Bademänteln und Handtüchern. Ein Knopfdruck, das Fließband surrt, der Lauf beginnt. Da es um diese Jahreszeit früh dunkel wird, brennt das Licht hinter mir im Sportraum und so sehe ich, wie sich mein rennendes Konterfei in der Glasfläche vor mir wiederspiegelt.
Eine Zeit lang betrachte ich mich beim Joggen und nehme dabei lediglich die Silhouette meines Körpers wahr. Nach einer Weile kommt allerdings die Frage in mir auf, wo denn die Außenanlage verblieben ist, die eigentlich genau in meiner Blickrichtung liegen sollte? Ich konzentriere mich, versuche meinen Fokussierungspunkt auf die Welt hinter meiner Spiegelung zu verschieben, doch in der Sekunde, in der mir das schließlich gelingt und ich einen Gast im Pool schwimmen sehe, verliere ich gleichzeitig auch den Blick für meine eigene Silhouette. Es ist ein lustiges Fokussierungsspielchen, das ich nun während meiner Sporteinheit betreibe: mal sehe ich ausschließlich die dunkle Projektion meines Körpers, dann blicke ich durch die Spiegelung meiner selbst hindurch und nehme lediglich den Pool, sprich die Außenwelt wahr und so geht es hin und her.
Irgendwo bei Kilometer sechs geschieht inmitten des spielerischen hin und her Verschiebens des Schärfepunktes, des tiefen Luftholens jedoch etwas eigenartiges, denn plötzlich fühle ich mich sorgenfrei, wie schon lange nicht mehr. Der gleichmäßige Atem begleitet mich nach Hause, ich bin in mir, anwesend, klar und frei von mich belagernden Gedanken und das stete Bedürfnis verändern zu wollen, weil der Augenblick doch so unvollkommen sei, er verlässt mich zusehends. Ich bin jetzt hier in einer voll ausgestatteten, perfekten Gegenwart und nehme dabei zugleich das Laufband, meine Spiegelung, den dahinterliegenden Pool, den Sportraum und mich, den Läufer wahr.
Schlagartig wird mir in diesem Moment klar, daß ich mich inmitten eines Gleichnisses befinde, in dem ein paar meiner so drängenden Fragen von gerade vorhin Antwort finden! Je nachdem wie der Fokus meines Bewußtseins eingestellt ist, bin ich entweder mehr mit der Außenwelt oder mehr mit der Innenwelt identifiziert und beschäftige mich mit den spezifischen Problemen dieser Ebenen. In der Sekunde, in der ich jedoch Beobachter der Szenerie bin und innerlich einen Schritt zurückgehe, die Gedanken aus dieser Vogelwarte beobachte oder sie als Impulsgeber in eine von mir vorgegeben Richtung sende, beziehe ich – frei von der Einflußnahme des Verstandes – eine neue Haltung jenseits des Denkens, und erlebe mich kurioserweise als … den Raum, in dem dieses Beobachten stattfindet, verstehe mein Wesen mehr als Gravitationspunkt, der mein eigentliches Ich, den Geist bündelt!
Dieses „beobachtende Auge des Raums“, das sich üblicherweise mit einem Körper und seinen dazugehörigen „Gedankengravuren“ identifiziert, ist der Rahmen, in den das pulsierende Leben mit seinem ewigen Formenspiel eingespannt ist und somit ist dieses Ich jenseits der Gedanken die feste Bezugsgröße, nach der ich so verzweifelt suchte! Wenn sich auch alles verändern mag; der Beobachter hinter dem sich mit Gedanken identifizierten Ich bleibt beständig, es ist das Wesen, welches sich so sehnsuchtsvoll aus jenem Verstandeskino befreien möchte, in dem die Vorstellung von Getrenntsein so fatal kultiviert wird und dabei erst dieses furchtgetriebene Verstandes-Ich entstehen kann! Jenseits meines gebräuchlichen Wahrnehmens, jenseits dessen was Gedanken erfassbar ist, liegt also eine andere Form des Seins, die – so meinte ich es für einen kurzen Augenblick erfrischend wahrgenommen zu haben – frei von zerfließenden und sich verflüchtigenden Gegenständen ist, die personalisierte Metaebene, die Gedanken ihrem Wirkprinzip entsprechend benutzt. Der Atem ist bei alledem der Zugang zu diesem „Raum-Ich“, denn in der Sekunde, als ich tief und ruhig Luft holte, kamen mir die Atemzüge wie die einzelnen Finger meines Geistes vor, die nach einer Phase des Schlafes zart tastend Orientierung suchten, ein Echolot, das die Wandung meiner Innenwelt abbildete, um dem Geist ein Gefühl für dessen herrliche Natur zu geben …
Ich stoppe das Band, wische mir den Schweiß von der Stirn, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob er vom Laufen oder der soeben gemachten Einsicht kommt und als ich mich auf den Weg in mein Zimmer mache, überkommt mich unerwartet ein wohltuender Frieden: alles was in diesem Formensturm auf mich einwirkt hat seinen Sinn, seine Berechtigung und Leid und Angst entsteht nur, wenn ich einen festen Platz in der Welt des Wandels suche! Die Furcht getrennt zu sein, die Furcht vor Verlust, der Irrsinn im Gang des Werdens und Vergehen Werte für die Ewigkeit zu finden, lösen sich nach und nach auf sobald ich mir klarmache der Rahmen zu sein, in dem dieser Wandel stattfindet. Es gibt nichts zu verlieren und der gnadenlose Zahn der Zeit muß keine Angst machen, denn das, woran mein Herz im Grunde so hängt, befindet sich hinter den Erscheinungen, hinter der Projektionsfläche der Gedanken, genau in dem Raum, der ich bin!