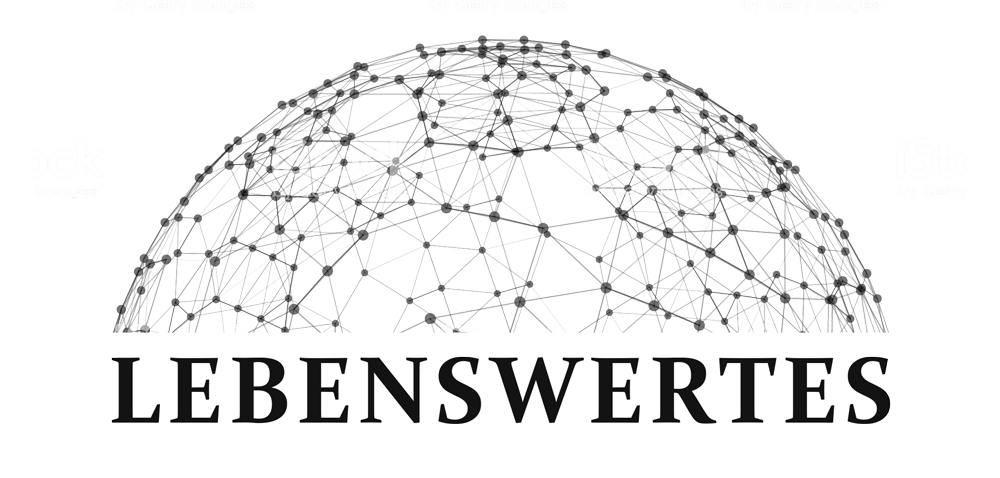Ein hagerer Milchbubi mit indischem Schokoladenteint namens Piscine Molitor Patel – kurz „Pi“ – und ein ausgewachsener bengalischer Tiger mit dem nicht minder ausgefallenen Namen „Richard Parker“ überleben gemeinsam mit einem Zebra, einer Hyäne und einem Orang-Utan (!) den wohl dramatischsten Schiffsuntergang der letzten Kinojahre, um – eingepfercht in einem kleinen Beiboot – als die beiden Letzten eines grausamen Existenzkampfs … erneut ums Überleben zu kämpfen – geht es eigentlich noch ein wenig dramatischer, bitte?!
Tatsächlich wird der eine oder andere Filmliebhaber wegen der vor der Kinopremiere gezeigten Appetizer zu Life of Pi geneigt gewesen sein, den ganzen Zauber angesichts dieser Ausnahmedramatik und visuellen Überzuckerung als eine Art „Edel-Bollywood-Schinken“ abzutun, dem man aufgrund seines zudem scheinbar so überbordenden Pathos durchaus den dramaturgischen Schiffsbruch zu „gönnen“ geneigt ist. Doch so zu denken wäre ein großer Fehler gewesen, so, wie es auch vor Jahren unangebracht gewesen wäre, Ang Lees kongeniales und ebenfalls oscardekoriertes Meisterwerk Tiger and Dragon wegen einer zu genretypischen Werbung zu verpönen. Wer seinen Vorurteilen derart auf den Leim gegangen ist oder sich dem bewegenden Schicksal des in einer Nußschale auf hoher See gestrandeten Duos immer noch verweigert, verpaßt zweifellos eines der wichtigsten Leinwandereignisse der letzten Jahre! Das cineastische Gebot lautet deshalb: Versäume diesen Film nicht – vor allem, wenn noch irgendwie die Chance besteht, die ganze Pracht auf großer Leinwand und in einer der bislang wohl eindrucksvollsten und intelligentesten 3D-Produktionen der Filmgeschichte zu bestaunen! –
Wer kennt sie nicht, die Geschichten jener armen Teufel, die aus guten Verhältnissen kommend, unverhofft in einen schicksalhaften Sturm geraten und binnen weniger Augenblicke jäh aus dem Gefüge ihres alten Lebens gerissen werden. Und weil sich der Mensch vor Gericht und auf hoher See bekanntlich besonders in der Hand einer höheren Macht wähnt, entpuppt sich die „Funkstille von oben“ als existentiellste Art der Zurückweisung, als katastrophaler Liebesentzug. Auch Pi, der jüngste Sohn eines atheistischen Zoodirektors, wird in einen solchen Sturm geraten. Er wird seine Familie, die mit dem Zoo aus Indien kommend im fernen Kanada einen Neuanfang wagen will, durch einen schaurig schönen Schiffsuntergang an die aufgepeitschte See verlieren und gemeinsam mit einem Tiger 227 Tage in einem kleinen Beiboot ums nackte Überleben kämpfen. Pis Leben wird jedoch trotz dieser nicht enden wollenden Pein auf der Hochseefolterbank nicht zum Scheitern verurteilt sein, denn in alledem ist es letztlich die unhinterfragte Akzeptanz der eigenen Geschichte, aus der er frei von lähmenden Zweifeln schöpfen kann. Man kennt die Kraft seines Glaubens eben erst dann – so Regisseur Ang Lee –, wenn er auf die Probe gestellt wird. Auf jeden Fall ist Pis Hingabe zu den großen Weltreligionen, seine Inbrunst beim Praktizieren aller möglichen Liturgien, wie sie der Film im rosafarbenen Kindheitsprolog zum Leben Pis sichtbar macht, kein Garant gegen schlimme Schicksalsschläge …
Yann Martel, dem mit 7 Millionen verkauften Exemplaren der preisgekrönten Filmvorlage „Schiffbruch mit Tiger“ ein literarischer Welterfolg gelang, hätte thematisch einfach die Enttäuschung leidgeprüfter Menschen aufgreifen können und das „himmlische Schweigen“ als Beweis dafür anführen, daß der Glaube an eine überirdische Welt, die rettend ins Geschehen eingreift, nicht mehr ist als eine Illusion, die regelmäßig verzweifelte Gemüter zurückläßt. Kann man, so gesehen, überhaupt an etwas glauben, das sich rationell gar nicht beweisen läßt? Life of Pi will – das macht die überirdische Schönheit der Bilder klar – mit dieser stumm im Raum stehenden Frage nicht dem Atheismus das Wort reden, sondern vielmehr ein fundamentales menschliches Problem vor Augen führen: den Zwist zwischen Ratio und Empfindung und den damit verbundenen Streit um die Deutungshoheit der beiden konträr erscheinenden Aggregatzustände. So umfassend das religiöse Wissen des jungen Pi auch ist, für wie überlegen sein atheistischer Vater die empirische Wissenschaft im Gegensatz dazu auch halten mag; wenn entscheidende Erfahrungen fehlen, kann sich ein unheilvolles, einseitiges Weltbild etablieren. So läuft auch Pi in seiner Schwärmerei Gefahr, lediglich eine Seite der Polarität zu verstehen und die andere, in sein Leben einbrechende Seite der Realität zu verdammen.
Der Überlebenskampf im kleinen Boot wird somit zur Grenzerfahrung zwischen sinnlich faßbarer Realität und einer diese überlagernden Schönheit jenseits der Sinne, in der dem Betrachter bald klar wird, daß es seine eigene Haltung ist, die den Blick auf das Leben „schaltet“.
Um das Wechselspiel möglicher Haltungen zu verdeutlichen, bedient sich der Streifen eines kleinen Kunstgriffes und versetzt den Zuschauer quasi in die Rolle eines Schriftstellers, der eine Geschichte sucht, die ihm den verlorengegangenen Glauben an Gott wiedergeben soll. Der Autor folgt dem Rat, einen Inder aufzusuchen, der dem Vernehmen nach die großartigste aller Geschichten kennt: es ist der in die Jahre gekommenen Pi. Dieser erzählt nun – im Film in epische Rückblenden gepackt – seine Erlebnisse. Zu seinem Erstaunen bekommt der Schriftsteller nun aber nicht nur eine, sondern gleich zwei Geschichten zu hören: eine schöne, harmonische, von phantastischen Erlebnissen begleitete, die, in eine Flut grandioser Bilder gekleidet, vom Sieg der Hoffnung handelt … und eine düster-realistische, die kurioserweise getarnt parallel läuft – bis im großen Finale die Frage im Raum steht, was sich denn nun auf hoher See während der 227 Tage ereignet hat: Wirklich die märchenhaft anmutende Annäherung eines Jungen und eines Tigers in einem kleinen Rettungsboot? Oder der brutale Kampf einiger Menschen ums nackte Überleben, wobei der Tiger und die anderen Tiere, die sich ursprünglich mit im Boot befunden hatten, nur Metaphern Teil eines Gleichnis waren, Repräsentanten für ein viel zu schmerzhaftes Trauma, für Grausamkeit, Schmerz und Bestialität.
Auch wenn dieser Variante nur wenige unspektakuläre, farblose Minuten gewidmet sind, bergen die darin liegenden Worte eine derartige Sprengkraft, daß sie binnen weniger Augenblicke die komplette Handlung zu drehen fähig sind und in Folge ein völlig anderer Film durch das Kopfkino rattert! Yann Martels geniale Parabel überläßt es am Ende dem Zuschauer, ob er sich für den schönen, gemütvollen, lebensnahen oder für den nüchtern-logischen Blickwinkel entscheiden möchte …
Auch wenn Life of Pi in Puncto Produktionskosten und Zuschauerzahlen auf Blockbuster-Niveau ansiedelt, ist der Streifen in seiner außergewöhnlichen Bildsprache und insbesondere aufgrund seines immensen Deutungsspektrums alles, nur nicht leicht verdauliches Popcornkino. Der große Erfolg an der Kinokasse überrascht um so mehr, wenn man bedenkt, daß ein Großteil der Einstellungen lediglich ein von Wassermassen umzingeltes Rettungsboot zeigt und verbal über weite Strecken nur durch die innere Zwiesprache eines schiffsbrüchigen Jungen getragen wird. Während ein ordentlicher „Seelendialog“ zum Pflichtrepertoire eines jeden Romanciers gehört und dieser Literarturgattung erst die beeindruckende Möglichkeit verleiht, in die verborgene Innenwelt eines Charakters vorzudringen, laufen Regisseure bei der filmischen Adaption großer Romane permanent Gefahr, die audiovisuelle Deutung solch subjektiver Empfindungsebenen zu sehr ins Konkrete zu übersetzen und dabei – abgekoppelt von der Bildwelt des Durchschnittspublikums – völlig asynchron zu chiffrieren. Die Frage, die Ang Lee zu Beginn der Dreharbeiten an den Rand der Verzweiflung getrieben haben könnte, lautet: Wie übersetzt man die ins metaphysisch reichende Wahrnehmung eines in Seenot geratenen Menschen, ohne das Publikum dabei mit Extremdialogen oder hart an der Grenze zum Esokitsch stehenden Bildern zur Verzweiflung zu bringen? Mit viel Instinkt und Einfühlungsvermögen umschifft Lee diese cineastische Dolmetscherfalle, in dem er die Umschreibung jener Innenwelt durch ein geniales Bildarrangement kurzum in die dritte Kinodimension transferiert und diesen neuartigen „Impulsraum“ zu einer Lichtbild morsenden Metaebene mit durchschlagender Symbolkraft umfunktioniert! So bündelt Lee seitenschwere Umschreibungen oft in nur einem einzigen 3D-Impuls, gewinnt dabei Erzählzeit und schafft Raum.
Am Ende, das zeigt das Leben des Pi, geht es nicht so sehr um konkrete Antworten auf Sinnfragen, sondern um die Art, wie man ins Leben fragt, sprich, wie viel Hingabe und Liebe trotz Schmerz und Verlust im Seelentimbre schwingen … denn man sucht – frei nach Anselm von Canterbury – nicht zu begreifen, um zu glauben, sondern man glaubt, um zu begreifen …