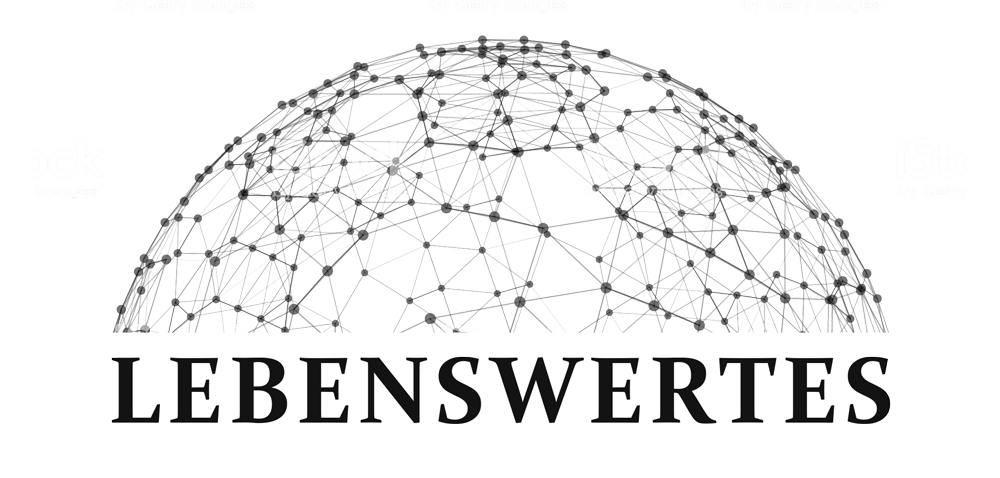Was ist das Geheimnis einer packenden Rede? Glaubt man Sprachforschern, so liegt die Würze eines Vortrags interessanterweise weniger am Inhalt des Gesagten, als vielmehr an der Art, wie man diesen Inhalt vorträgt! Stimmkraft, Körpersprache, ein sicherer Blick entscheiden demnach darüber, wie das Publikum die Worte wahrnimmt, welcher Wert der Rede beigemessen wird. Doch wieso verblaßt der Gehalt der Worte hinter dem Auftritt, strahlt gerade hier der Schein offenbar mächtiger als das Sein? Betrachtet man das Auditorium während eines Vortrags, so bergen besonders die ersten Minuten wichtige Hinweise zur Klärung dieser vermeintlichen Paradoxie. Hinter gehobenen Augenbrauen, der Aufbruchsstimmung und Aufgeschlossenheit, die zu Beginn noch fühlbar in der Luft liegen, steht zusammengefaßt wohl nur eine bange Frage: kann ich diesem Menschen vertrauen? Steht der Orator fest in seinem Wort? War er dort, in der Wortwirklichkeit, und kehrte er von seiner Reise als Überzeugter zurück? Ist ein Redner tatsächlich von dem Wort ergriffen und schwingt in dem Gesagten spürbar erlebtes Wissen, so vermag er den Zuhörer zu einer gewaltigen Entdeckungsreise in dessen eigene Innenwelt zu führen. Seine Worte werden so zur Brücke, über die jene erfrischende Kraft des Ursprungs in die Seele des aufmerksamen Zuhörers fließen kann, die sich zuvor im Erleben des Sprechers offenbarte! Verwundert es da, daß ein Zuhörer, bevor er den Steg zu schwindelerregenden Höhen, zu metaphysischen Weiten betritt, zunächst die Plankenstärke der Brücke, sprich die Unerschrockenheit und Empfindungstiefe des Dozenten bemißt? Die Aura der Überzeugung, der Authentizität ist es somit, nach der das Publikum zunächst instinktiv tastet und als Grundvoraussetzung für das vertrauensvolle Sich-Öffnen in der Ausstrahlung, Stimmkraft oder Körpersprache des Referenten abfragt. Ob ein Zuhörer sich „mitnehmen“ läßt, liegt in der Klarheit des Bildes begründet, das der Sprecher von den Dingen hat, in dessen Fähigkeit, den Wegweiser zum Erleben so ungetrübt wie möglich an den Begriff zu binden.
Was sich vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge auf den Rängen des ehrwürdigen Wembley-Stadions bereits in der ersten Szene des Oscar-Abräumers 2011, „The King’s Speech“ abspielt, atomisiert den Eckpfeiler guter Reden, wonach die Stärke der Sprachbrücke an der Haltung des Sprechers, an dessen Mut und Mitgefühl abzulesen sei. Die Katastrophe, die dem Hauptdarsteller hier widerfährt, hinterläßt ihn mit einem maskenhaften Gesicht voller Angst. Dem Cineasten beschert der Moment hingegen einen phänomenalen Filmbeginn, der ihn in den Konflikt des Protagonisten katapultiert!
Albert Frederick Arthur George (Colin Firth), von Freunden kurz Bertie genannt und seines Zeichens Herzog von York, obliegt die Aufgabe, eine Rede zur Abschlußveranstaltung der British Empire Exhibition zu halten. Das müßte für einen Aristokraten, der sich auf die Kunst der Rede verstehen sollte, eigentlich eine einfache Angelegenheit sein, ist es aber in dem speziellen Fall nicht: der stotternde Herzog bekommt nämlich keine zwei Sätze heraus, ohne daß er dabei ins Stocken gerät, ohne daß sich quälend lange Sprechpausen an plötzlich angreifende Wortsalven reihen. Wie eine aggressive Kobra starrt das überdimensionale Mikrofon auf den Sprecher, visiert ihn hypnotisch an. Langsam, Stück für Stück pirscht sich der Duke von York vor der Kulisse einer prallgefüllten und dabei gespenstisch stillen Trabrennbahn an jene akustische Lupe, die in wenigen Augenblicken sein Gebrechen verstärken, seine Angst zu den respektvoll von den Sitzen erhobenen Zuschauern transportieren wird. Peinliches Berührtsein und Enttäuschung liegen als Folge des Auftritts in den verunsicherten Blicken der Zuhörer, da einer, den man als Pfeiler der Monarchie stark erleben wollte, sich als beängstigend schwach und verletzlich entpuppte. Dem Prinzen bleibt als dem Zweitgeborenen ohne direktes Anrecht auf die Königskrone wenigstens der Trost, daß er in Zukunft solch schmerzhaft repräsentative Aufgaben nur recht selten wahrnehmen muß.
Dessen ungeachtet stellt sich Albert George tapfer seinem Problem und begibt sich dabei in allerlei – meist dubiose – Behandlungen. Während der Adlige nach etlichen Therapieversuchen bald entmutigt das Handtuch wirft, bleibt seine Gattin Elisabeth (Helena Bonham Carter) auf der Suche nach einem geeigneten Logopäden beharrlich und landet am Ende beim einem ebenso unorthodoxen wie eigenwilligen Australier namens Lionel Logue. Der Sprachtherapeut, dargestellt von einen brillanten Geoffrey Rush, läßt, selbst nachdem ihm die wahre Identität des anfänglich inkognito auftretenden Patienten erklärt wurde, nie einen Zweifel daran, wer in seinem Behandlungsraum die Krone trägt. Während der Therapie, so die Regel, wird seine Hoheit ganz profan und sehr zu deren Ärger mit dem Kosenamen Bertie angesprochen, und auch der Versuch, zumindest das Privatleben gänzlich in der standesgemäßen Tabuzone zu belassen, übergeht der Sprachheiler mit engagierter Ignoranz!
Wie sich später herausstellen soll, haben diese Maßnahmen durchaus einen Hintergrund. Der Gelegenheitsschauspieler und Shakespeare-Enthusiast greift auf ein von ihm intuitiv entwickeltes System zurück, das er für die traumatisierten australischen Soldaten des I. Weltkrieges konzipierte. Vertrauen, Gleichheit und die Nähe eines Freundes, der zuhört, sind für Lionel Logue ge- und erlebte Prinzipien seines Kriegsdienstes, die auch beim Hochadel funktionieren sollten. Doch bis zur Praxis kommt es in diesem Falle zunächst gar nicht, da der Herzog, entnervt von den sich darstellenden Gepflogenheiten, schnell das Weite zu suchen geneigt ist. Bevor der Prinz aber die erste Sitzung verlassen kann, schlägt ihm der Therapeut kurzentschlossen eine interessante Wette vor, die in der Garantie besteht, daß es der Stotterer aus dem Stehgreif schaffen kann, einen Abschnitt aus Shakespeares „Hamlet“ – was sonst? – zu sprechen, ohne dabei ein einziges Mal aus dem Redefluß zu geraten! Logue nimmt hierfür die Worte der Herzogs mittels eines Grammophons auf, während er den Sprecher gleichzeitig per Kopfhörerbeschallung akustisch von seinen leidgeprägten Hörgewohnheiten trennt. Ein beeindruckendes Experiment, das vom ungeduldigen Herzog jedoch in Erwartung des üblichen frustrierenden Ergebnisses jäh unterbrochen wird, ohne dabei das Ergebnis abzuwarten. Als sich der Prinz, in der Residenz angekommen, schließlich jene Schallplatte das erste Mal anhört, ist die Verwunderung über seine erste stotterfreie Rezitation riesengroß! Natürlich ist das Eis durch den Erfolg nun vollends gebrochen und so können die beiden sich an teils witzige, teils skurrile, aber für den Zuschauer immer unterhaltsamen Sprachübungen machen …
Als Georges Bruder David nach dem Tod des Vaters den Thron erben soll, kommt es wegen seiner geplanten Hochzeit mit einer geschiedenen Frau zum Eklat, in dessen Folge der Kronprinz dem Thron entsagt. Anstelle Davids soll nun George – als König George der VI. – nachrücken, eine Pflicht, die den sensiblen Monarchen in heftige innere Kämpfe und noch größere Selbstzweifel stürzt. Doch damit nicht genug! Im Herzen Europas bläst just in dieser fragilen Umbruchsphase der englischen Monarchie ein ebenso größenwahnsinniger wie wortgewandter Demagoge zum Sturm auf die ganze Welt. Zum Amtsantritt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erwarten den Kronprinzen also zwei wichtige Ereignisse, die eines mutigen Mannes bedürfen: die Krönungszeremonie und … „The King’s Speech“, die offizielle Radioansprache des Königs zum bevorstehenden Kriegseintritt! Unter Hochdruck bereiten sich die beiden auf die Reden vor, die von der BBC weltweit übertragen werden. Einen Tag vor Amtsantritt versucht der Therapeut seinen panischen Freund durch einen hitzigen und bewußt provozierten Streit im Westminster Abbey aus der Reserve zu locken. Der Disput eskaliert, als Lionel Logue sich auf den Thron setzt und dabei die Insignien der Macht verhöhnt. Durch die Trivialisierung hehrer Symbole in Rage versetzt, herrscht ihn der König an, befiehlt seinem Sprachlehrer den Thron zu räumen und als dieser unbeeindruckt fragt, wieso er ihm überhaupt Folge leisten solle, eröffnet der brennende Schlüsselsatz „Weil ich eine Stimme habe!“ das Tor zu jener Brücke, über die endlich das Leben in den strebenden Monarchen fließen kann! In der überaus wichtigen Szene schafft es der Therapeut einen von seinem Leiden in Zweifel geschlagenen Menschen in seine Berufung als König zu führen! Am Ende bleibt die große Rede, die Regisseur Tom Hooper mit einer gehörigen Portion britischem Understatement inszeniert. Kein lauter Paukenschlag, kein Pathos, nur die packende Rede eines Mannes, der es durch die Liebe eines Freundes schafft, sich selbst zu überwinden. In dem kleinen Aufnahmeraum, der mit der Welt Verbunden ist, dirigiert Lionel in einer grandios gezeichneten „Gänsehauteinstellung“ Berties Worte, souffliert stumm, während Beethovens 7. Sinfonie die Szene in unglaubliche Höhen trägt! Collin Firths Rolle als stotternder König, für die er, völlig verdient, den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt, transportiert auf eindrucksvolle Weise den Kampf und die Tragik der beiden Menschen, des Stotterers und des Königs, die Regisseur Tom Hooper schließlich in so meisterhafter Weise miteinander versöhnt.