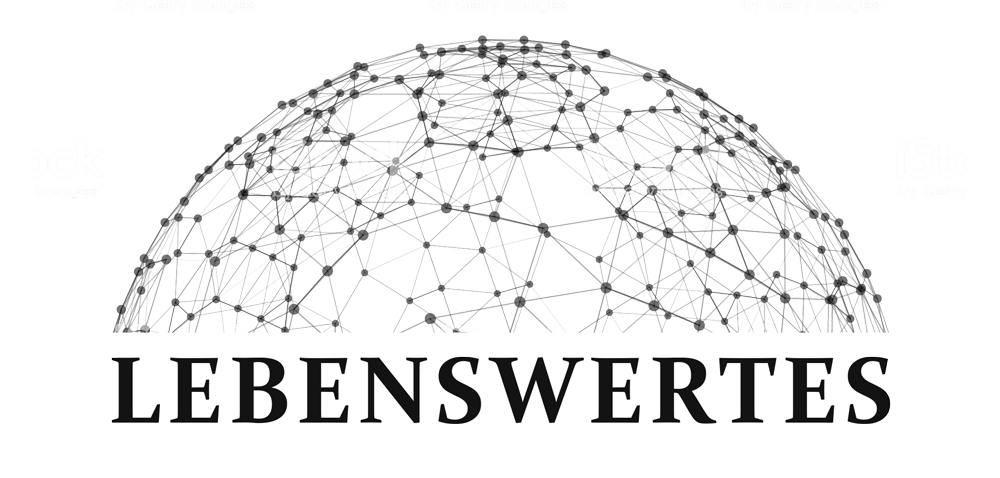Es mag im Taumel des heute gebräuchlichen Hedonismus und der Sucht nach Selbstverwirklichung bereits fremdartig klingen, doch kann kein Mensch alleine frei sein. Die Reise hin zum „durchgeistigten Individuum“, einem mündigen Wesen also, das sich des tierischen Erbes entledigt hat und Herr seiner Innenwelt geworden ist, entwickelt sich erst durch die zahllosen Begegnungen mit Mensch und Tier, in den prägenden Impulsen aus Natur und Kultur. Dabei ist der Nächste einerseits unverzichtbare Projektionsfläche, um sich selbst und seine Art überhaupt verstehen und erkennen zu können, andererseits bedarf es der Erfahrung einer in fördernden Gesetzmäßigkeiten antwortenden Welt, deren Prinzipien man bei entsprechender innerer Haltung gewillt ist, in sich abzubilden und dabei zu einem Teil des Gewissens werden zu lassen!
Im Windschatten dieses „Wertetransfers“ entwickelt sich bald schon ein lebendiges Sensorium im Herzen des Menschen, jenes pulsierende Kraftfeld in der Seelenmitte, das zu den zahllosen Ereignissen des Lebens spürbar Stellung bezieht und damit den Träger der in solcher Freiheit anwachsenden Überzeugung durch die Stimme des eigenen Gewissens in die Pflicht nimmt und führt!
Pulsiert dieses Herz nicht im Takt eines verinnerlichten Gesetzes, weil wie heutzutage der Blick auf die metaphysische Welt und der darin eingewobenen Werte durch reine Arterhaltung und Existenzsicherung verbaut ist, so müssen von Instanzen auferlegte Gebote, Regeln, Gesetze durch die altbewährten Regularien „Befehl und Gehorsam“, „Schuld und Sühne“ das fragile Miteinander vor dem Chaos individueller Wunschbefriedigung und der damit verbundenen Verrohung der Sitten bewahren, zu der eine „sinnskeptische“ Gesellschaft ohne geistige Bindungskräfte tendiert. Ein derartiger Mensch mutiert irgendwann zur „Moralmaschine“, die äußerlich angepaßt „gut tut“, solange er sich beobachtet fühlt, im Grunde aber mangels eigener Erfahrung gar nicht weiß, wieso gut gut ist!
Das Problem von äußerlich gelebten Geboten, von Moral und Verhaltenskodizes besteht letztlich in der Tatsache, daß nichts Nachhaltiges aus der Absicht entstehen kann, etwas einfach nicht zu tun. Während ein nach Freiheit Strebender wie ein Entdecker aus Eigeninteresse heraus eine Vision zu verwirklichen sucht und dabei nach und nach eigenes Erleben und Erkennen etabliert, verharrt der dem kleinsten gemeinsamen moralischen Nenner ergebene Mensch, „motiviert“ von der Furcht vor Strafe und dem Verlust von Anerkennung am Hinweisschild des Gebotes, ohne den gewiesenen Weg prüfend weiterzugehen und mit Leben zu füllen.
Doch ist Furcht, sprich das Vermeiden von Situationen, die zu Veränderungen führen, stets auch Garant und Indikator für ein falsches, meist unglückliches Leben! Mehr noch; in der durch Furcht entstehenden Kluft zwischen Sein und Schein, zwischen plumper Regeleinhaltung und der Liebe zum „inneren Gesetz“, zwischen „Du sollst“ und „Ich will“ baut sich im Wertevakuum allmählich eine unberechenbare Kraft auf, die sich unter bestimmten Vorzeichen in einem anarchischen Reflex entlädt und dabei die eigene Doppelmoral und Bigotterie gnadenlos ans Tageslicht zerrt … Diese Ausgleichskraft wird dem in „Empfindungs-Mimikry“ verharrenden Menschen solange zur Quelle von Unglück und Leid, bis der zugrundeliegende Widerspruch beseitigt ist und Handeln und Empfinden im Einklang stehen! Ohne die Stimme des Gewissens obsiegt die in den Windungen des Verstandes lauernde Irrationalität, die das Zivile im Menschen auflöst und zum Rückfall in kindliche Logik oder stammesgeschichtliches Verhalten mit den dazugehörigen Tragödien führt – und genau hier, zwischen Uniformität und Genuinität, waltet auch der „Gott des Gemetzels“, jene archaische Kraft, dessen „Güte“ im schonungslosen Herunterreißen verlogener Masken zum Zwecke der Erneuerung besteht …
An sich ist die 2011 von Regie-Altmeister Roman Polanski verfilmte Theateradaption mit dem so martialischen Namen „Der Gott des Gemetzels“ rasch erzählt. Der Minimalismus dieser Tragikkomödie ist Programm, beruht das gleichnamige und äußerst erfolgreiche Theaterstück von Yasmina Reza doch auf einem interessanten, kammerspielartigen „Gedankenexperiment“, dessen große Dynamik zu erzeugen es lediglich zweier kleiner Räume bedarf: der Kulisse eines Wohnzimmers und des Raums im Kopf des Zuschauers!
Reza geht es demnach weniger um das Zeichnen einer spezifischen oder besonders originellen Geschichte, als vielmehr um die Beleuchtung von Strukturen, die erst zu den vielen merkwürdigen Geschichten und alltäglichen Dramen führen. Auch Polanski bedient sich dieses minimalistischen Stils; eine sichere Bank angesichts der von Reza genial ausgearbeiteten Dialoge, die so punktgenau dem alltäglichen Wahnsinn abgelauscht scheinen! Dank dieser akribischen Vorarbeit genügen schon wenige Impulse, um die psychodynamischen Mechanismen dies- und jenseits der Leinwand in Gang zu setzen: ein kleiner Aufreger zu Beginn des Streifens, ein bißchen Alkohol, der die Protagonisten aus der Reserve lockt, dazwischen zermürbender Streß, verursacht durch einen dauertelefonierenden Advokaten …
Eine Gruppe Kinder gerät in einem Park, irgendwo in New York, in Aufruhr, weil plötzlich mitten unter ihnen zwei Hitzköpfe aneinandergeraten. Nach einigen Drohgebärden eskaliert der Streit schließlich, als sich einer der Kontrahenten einen herumliegenden Stock greift und damit seinem Widersacher dummerweise zwei Zähne herausschlägt. Sicher, eine unschöne Szene, die man durchaus filmisch weiterspinnen könnte, wäre angesichts der unspektakulären und wortlosen Kameradarbietung – einer sterbenslangweiligen Teleobjektiveinstellung – nicht längst schon klar, daß sich emotionales Engagement in diesem Prolog noch nicht lohnt. Nach der Keilerei ist vor der Keilerei! Explosiv wird es tatsächlich erst, als sich Nancy und Alan Cowan (Kate Winslet und Christoph Waltz), die Eltern des „Täters“, in Penelope und Michael Longstreets (Jodie Foster und John C. Reilly) Apartment einfinden, um mit dem – hauptsächlich von Alan ganz offensichtlich mehr als Last empfundenen – Kondolenzbesuch auch gleich noch die versicherungstechnischen Formalitäten zu erledigen. Daß die Longstreets und Cowans, namentlich Penelope und Alan, sich nicht grün sind, wird schon beim allerersten Dialog des Films, dem Verfassen des „Tatherganges“, deutlich. Die Gleichgültigkeit Alans gegenüber einem seiner Ansicht nach belanglosen Bagatellfall versetzt die prinzipientreue Penelope in Rage. Gereiztheit liegt in der Luft, die sich bald im einsilbigen und formvollendeten Zynismus Alans – Waltz Meisterdisziplin – und den bohrenden Äußerungen Penelopes niederschlagen.
Auch der Zuschauer bleibt von den sich aufschaukelnden Gefühlen nicht verschont. Kein Wunder, rotten sich in dem kleinen Apartment doch vier Menschen zusammen, die einander in ihrem Welt- und dem daraus induzierten Selbstbild nur „Götter des Gemetzels“ sein können! Da wäre die „Afrikaversteherin“ und angehende Sachbuchautorin Penelope, die mit ihrer leicht neurotischen Art, ihrem verstohlen elitär daherkommenden Gutmenschentum so sympathisch wie Bauchschmerzen ist. Michael, Penelopes Mann, zeigt sich zunächst als erdiger Kumpeltyp und nahezu perfekter Ehepartner, mutiert aber im Verlauf des Streifens vom Pantoffelhelden zum rabiaten, „hamsterkillenden“ Macho, und als noch Nancys selbstsichere Investmentbanker-Fassade bröckelt, offenbart sich dahinter grenzenlose Verzweiflung und Orientierungslosigkeit. Gerade Alan, der nüchterne Rechtsanwalt, dem jegliches Verständnis für kaschierende zwischenmenschliche Töne fehlt, avanciert in dieser Gemengelage, trotzdem er eine so üble Type ist, kurzzeitig zum Sympathieträger.
Im Grunde ist Alan nur ein Winkeladvokat, einer, der es ohne Gewissensbisse fertigbringt, während der Schlichtungsrunden, wo es doch um Anstand und Moral geht, permanent lautstark am Telefon zu hängen und dabei einen miesen Pharmakonzern und sein soeben in die Schlagzeilen geratenes Präparat durch üble Haarspalterei noch ins rechte Licht zu rücken. Moralisch ist hier nichts zu reißen, doch macht Alan hieraus auch gar keinen Hehl. Er verteidigt ja nur die Werte seiner Mandanten, und das wiederum macht ihn – obwohl eigentlich völlig unmoralisch – zur souveränsten Person in der Runde … wenngleich auch seine Fassade bröckeln soll, als im Laufe der eskalierenden Streitereien die alkoholisierte Gattin in einer Kurzschlußreaktion sein Handy – sein Lebenszentrum! – schnappt, in eine wassergefüllte Vase wirft und damit beinahe einen Nervenzusammenbruch des ansonsten so stoischen Ehemanns riskiert.
Es ist an diesen „Unfallstellen“ der Klasse des Drehbuchs, vor allem aber der herausragenden Leistung dreier wunderbarer Oskar-Preisträger und eines Daueraspiranten auf die heißbegehrte Trophäe zu verdanken, daß aus dem tendenziell überpointierten Schauspiel kein billiger Mummenschanz wird, sondern ein unterhaltsamer Grenzgang, der in bester Loriot-Manier urkomisch daherkommt, im Grunde aber einem todernsten Thema folgt!
Je länger der „Elternabend“ dauert, je mehr Worte und Erklärungen im Raum stehen, desto verfahrener wird die Situation. Dabei hätten beide Parteien immer die Möglichkeit, den Kriegsschauplatz zu verlassen! Tatsächlich stehen die Cowans auch dreimal im Flur, um sich zu verabschieden, doch jedes Mal – sei es, um insgeheim noch einmal etwas grundlegend klarzustellen, die gutmenschliche Fassade aufrecht zu erhalten oder die bildungsbürgerliche Diskurskultur zu wahren – finden sich die Parteien unter einem nichtigen Vorwand wieder in der Kampfarena ein.
Ehe man sich versieht, gerät die Situation letztlich völlig außer Kontrolle, gerät zum aberwitzigen, teils surrealen Schlagabtausch zwischen sich dynamisch wechselnden Lagern: Ehepaar gegen Ehepaar, Männlein gegen Weiblein, alle gegen einen, einer gegen alle, alle gegen alle – ein emotionales Chaos, das die akribisch gepflegten und so plakativ nach außen getragenen Werte, Vorstellungen und Weltbilder mit jeder Runde weiter atomisiert, der Absurdität preisgibt und im Sog dieses verzehrenden Werterelativismus nur Verlierer hinterläßt, das aber dem Raum im Kopf des Zuschauers dennoch jene heilenden Impulse vermittelt, die im Wiedererkennen eigener Verhaltensfacetten wurzeln.