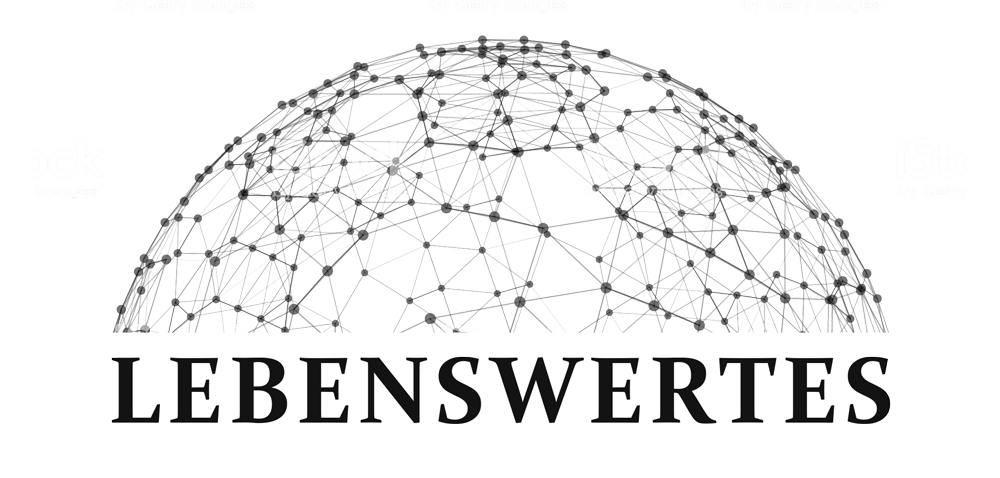Fragt man namhafte Schauspieler nach ihren anspruchsvollsten Rollen, so sprechen sie in den meisten Fällen von der Verkörperung psychisch kranker Menschen. Dustin Hoffman hat im Vorfeld zum äußerst populären Film „Rain Man“ beispielsweise beinahe zwei Jahre (!) mit einem Psychologen zusammengearbeitet, um sich glaubhaft in die isolierte Welt eines autistischen Menschen zu versetzen. Unter ähnlicher Pein erarbeiteten sich auch Robert De Niro und Jack Nicholson in „Zeit des Erwachens“ und „Einer flog übers Kuckucksnest“ ihre Rollen. Während es den Darstellern eine gehörige Portion Talent und viel Schweiß und Mühe abverlangt, glaubhaft den Eindruck einer Krankheit zu vermitteln, die sich zu aller Schwierigkeit noch unsichtbar im Innersten eines Menschen abspielt, machen es sich viele ökonomisch orientierte Filmstudios zu leicht, wenn sie die Rolle des „kranken Helden“ auf immer dieselben Klischees reduzieren. Bei näherer Betrachtung ähneln sich nämlich verdächtig viele der Film-Irren, „torkeln“ an der Grenze zur Genialität herum, eröffnen in ihrer Unkonventionalität Sichtweisen, die „Normalen“ abhanden gekommen sind, kurz: kantige, aber liebenswerte Erfüllungsgehilfen, die durch ihre unschuldige Art für Gänsehaut, Rührung und volle Kassen sorgen! Leider haben sich die Filmpsychiatrien seit den Zeiten der erwähnten großen drei Filme bis auf ein paar Ausnahmen nicht mehr sichtlich verändert. Vielmehr nervte das Genre häufig durch affektierte Schauspielerei und dumme Dialoge.
Mit dem 2001 erschienenen Streifen „A Beautiful Mind“ von Regisseur Ron Howard und dem Drehbuchautor Akiva Goldsman knüpfte dieses Kino allerdings mehr als nur wieder an die großen Filme der Vergangenheit an. Ähnlich wie es 1999 Shyamalan in „The Sixth Sense“ beeindruckend zur Schau gestellt hatte, schaffen es auch Howard und Goldsman, durch einen cineastischen Kunstgriff das gewohnte Rollenverständnis des Zuschauers heimlich „auszuhebeln“, so daß der Betrachter sich plötzlich zur größten Verblüffung inmitten der Wahnwelt eines an Schizophrenie leidenden Menschen wiederfindet – ein erfrischend neuer und längst überfälliger Perspektivwechsel!
Wie so oft bei dieser Art von Filmen, erzählt auch „A Beautiful Mind“ die reale Biografie eines Menschen, des Mathematikers und spät dekorierten Nobelpreisträgers John Forbes Nash, dessen Vita alle Dramatik für einen packenden Streifen mitbringt: Als Schüler Einsteins entwickelte der 21jährige Nash an der Princeton Universität seine in Fachkreisen bekannte Spieltheorie, die bis heute fester Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften ist. Noch bevor er jedoch seine Arbeiten weiterführen konnte, erkrankte der junge Mann an paranoider Schizophrenie, deren Folge gesellschaftlichen Abstieg und das Martyrium psychiatrischer Behandlungen nach sich zog. Nash schafft es letztlich, sich aus eigener Kraft mit der Krankheit zu arrangieren und sein „Hauptleben“ neben all den Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu verteidigen.
Goldsman und Howard halten sich bei ihrer Verfilmung nur im weitesten Sinne an die zugrunde liegende Buchvorlage der Journalistin Sylvia Nasar, deren prämiertes Literaturwerk Nash eher als das wiedergibt, was er neben seinem Genie und ergreifenden Kampf gegen die Krankheit eben auch ist: ein, um es gelinde auszudrücken, menschlich äußerst streitbarer Charakter! Die Besetzung der fragilen Hauptfigur durch Russell Crowe, bekannt als muskelbepackter Held aus „Gladiator“, verblüfft anfänglich. Doch Crowe brilliert in dieser Rolle als introvertierter Genius und schizophrener Grenzgänger und erhielt für seine überragende Darstellung einen der insgesamt vier Oscars, die es 2001 für diesen Streifen gab.
Goldsmans Drehbuch teilt Nashs Leben in große Abschnitte, deren narrative Grenzen jedoch homogen ineinanderfließen. In den ersten Jahren auf dem Campus sieht man einen kauzigen und arroganten Einzelgänger, der krampfhaft an seinem wissenschaftlichen Durchbruch arbeitet.
Schnell wird klar, daß seine unsicher-überhebliche Art keinem eingebildeten, sondern Nashs tatsächlichem Genie entspringt. Am deutlichsten wird dies in den vielen Bildcollagen, in denen das Publikum durch Nashs Augen blicken darf und dank moderner Tricktechnik das sieht, was der Mathematiker vor seinem geistigen Auge wahrnimmt. So wird man Zeuge, wie aus den unterschiedlichsten Gegenständen im Raum sich ähnelnde Strukturen kristallisieren, die in Nashs Gedankenwelt effektvoll zur Deckung gebracht werden. Diese Fähigkeit ist es auch, die ihn so einzigartig macht: er sieht Muster im Chaos und findet deren Gemeinsamkeit in der Mathematik. Es mag, so betrachtet, vielleicht ein wenig einfallslos wirken, wenn Howard seinen Hauptdarsteller mit weißem Wachsstift in den dunklen Gemäuern der altehrwürdigen Universität auf die Scheibe eines großen gotischen Spitzbogenfensters mathematische „Formelkolonnen“ schreiben läßt. Die Symbolkraft des Bildes beeindruckt dennoch, da es Nashs Situation in der Isolation seiner Scheinwelt treffend wiedergibt – eine Welt, in der Zahlen wie Lichtfäden erscheinen, wie ein transzendenter Wink aus der Unendlichkeit, der Nash für kurze Zeit an etwas Übergreifendem, Universellem teilhaben läßt!
Es dauert nicht lange, bis auch das Militär auf Nashs Fähigkeiten aufmerksam wird und ihn als „Wunderwaffe“ im kalten Krieg mit der Sowjetunion einsetzt. Diese Liaison bringt dem mittlerweile zum Professor aufgestiegenen Nash zwar einige Vorteile, wie einen gut bezahlten Lehrstuhl an der Fakultät, sie bringt ihm aber auch die unheilvolle Bekanntschaft mit dem mysteriösen CIA-Agenten Parcher (Ed Harris), der den Professor unbedingt für weitere hochgeheime Missionen verpflichten möchte.
Nashs Aufgabe ist es fortan, einen komplizierten Code zu entschlüsseln, den sowjetische Spione in Form von Artikeln und Anzeigen in einer Unzahl von handelsüblichen Zeitungen und Journalen gestreut haben sollen, um so miteinander chiffriert zu kommunizieren. Während Nash durch diese Geheimdiensttätigkeiten immer tiefer in einen gefährlichen Agentenkrieg stürzt, beschleicht den Zuschauer zunehmend das Gefühl, nun komischerweise in einem Politthriller zu sitzen. Genau am Höhepunkt dieses vermeintlichen „Agentenspektakels“ löst der Regisseur dann sein Geheimnis auf, von dem weder Nash noch der Zuschauer etwas ahnten: der größte Teil der bisherigen Geschichte spielte sich nur im Kopf des Wissenschaftlers ab, war reine Illusion! Alle Gebäude, Gespräche, die schweißtreibende Verfolgungsjagd, Parcher und dessen CIA-Aufträge, selbst Nashs bester Freund aus Princeton-Zeiten, Charles, den man als Zuschauer schon in sein Herz geschlossen hatte – nichts war real, sondern lediglich Produkt eines Gehirnes, das seine eigene Wirklichkeit präsentiert!
Während dem Publikum nun nach und nach das gesamte Ausmaß der eigenen „Bewußtseinsstörung“ klar wird, dauert es für Nash noch lange, bis er seine Krankheit überhaupt anerkennt – und lernt, damit umzugehen. Die späte Erkenntnis verändert zwar schließlich seine Einstellung, doch lassen seine „Freunde“ aus der Innenwelt nicht von ihm ab. Bis zuletzt tauchen sie immer wieder auf, und das auf so glaubhafte und eindringliche Weise, daß selbst der aufgeklärte Zuschauer für Augenblicke das Gefühl hat, die falsche Wirklichkeit gehöre zu Nashs realem Leben!
Dieser durchleidet die psychiatrischen Behandlungsmethoden der fünfziger Jahre mit ihren schrecklichen Elektroschock- und Insulinbehandlungen. Schließlich entscheidet er sich aber dafür, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und seine innere Ohnmacht mit eisernem Willen zu überwinden. Diese Zeit durchsteht er nur durch die liebevolle und aufopferungsvolle Hilfe seiner Frau (Jennifer Connelly), welche ihm inmitten des Wahnsinns ein Fels in der Brandung ist.
Wenngleich der Film auch alle Register eines amtlichen Blockbusters zieht, geht „A Beautiful Mind“ einen wichtigen Schritt weiter. Der Film führt sein Publikum sozusagen „in eigenem Erleben“ in die Welt des Schizophrenen. Und daraus entsteht mehr als nur Mitleid oder Scheu – nämlich Verständnis für die Hölle einer Wahnpsychose.