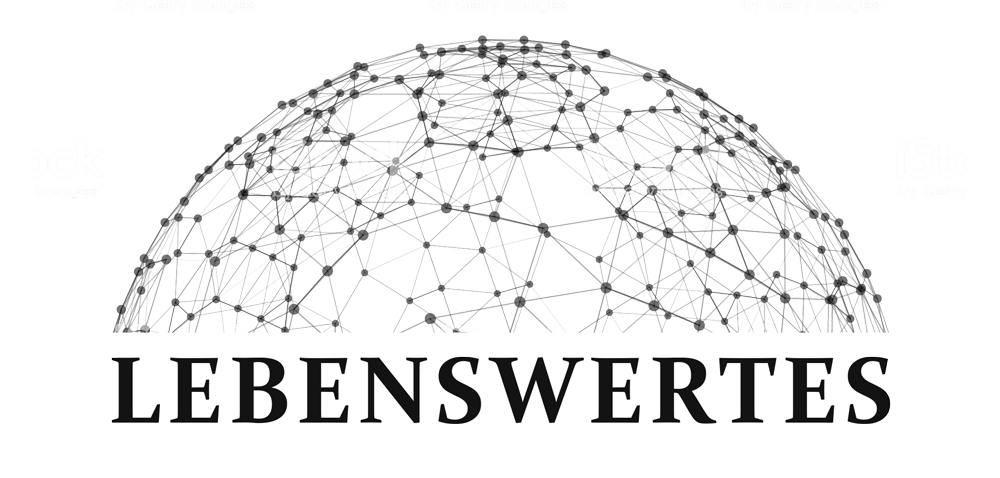Willi Mönikheim ist Pfarrer mit Leib und Seele. Er ist einer jener Menschen, die hinter die Buchstaben blicken und mit ihren Äußerungen und Predigten zeitlos, fast möchte man sagen überkonfessionell bleiben. Wir erlebten den Pensionär am Bauerntag zu Lichtmeß in Wolpertshausen bei einer wunderbaren gesellschaftskritischen Andacht zum Thema »Der Turmbau zu Babel« – die der sympathische Pfarrer aus Bad Mergentheim komplett in Mundart, also auf »Hohenlohisch« hielt!
Herr Mönikheim, was sind eigentlich die Aufgaben eines Bauernpfarrers?
Willi Mönikheim: Im christlichen Glauben spielt die Landwirtschaft eine immense Rolle. Die Bauern haben aus Sicht der Bibel seit jeher den Auftrag, die Erde zu bebauen und die gute Schöpfung, die uns anvertraut wurde, im Sinne Gottes zu bewahren. Der Bauernpfarrer unterstreicht diesen Leitgedanken der Bibel, indem er die schöpfungsbewahrende Arbeit der Bauern und somit das „Bauernwerk“ geistig begleitet und unterstützt.
Die Aufgaben des Bauernpfarrers sind dabei vielfältig. In jedem der 50 Dekanate unserer Evangelischen Landeskirche in Württemberg gibt es beispielsweise landwirtschaftliche Arbeitskreise. In diesen Arbeitskreisen, dem Evangelischen Bauernwerk, treffen sich Menschen aus der Landwirtschaft oder Landwirtschaftsverwaltung, aber auch einfach nur interessierte Personen, die ihren Beitrag dazu leisten wollen, die Schöpfung zu erhalten. Zu diesen regelmäßigen Treffen wird oftmals auch der Bauernpfarrer eingeladen.
Wenn zum Höhepunkt des Jahres ein Hoffest stattfindet, wird der Bauernpfarrer ebenfalls eingeladen, den morgendlichen Gottesdienst zu gestalten. Manchmal wird dann auch ein Feldrundgang organisiert, bei dem der Bauer den Besuchern erklärt, welche Arbeiten auf den Feldern anfallen, was ihm dabei wichtig ist, oder welche Sorgen ihn plagen. Bauernpfarrer und Bauernwerk pflegen außerdem Beziehungen zum Bauernverband, zu Landfrauen und Landjugend und sind zuständig für den Kontakt zum Landwirtschaftsministerium.
Die Tätigkeitsfelder sind also sehr weitreichend und abwechslungsreich. Im Grunde verstehen wir uns als eine soziale und religiöse Klammer zwischen der Landbevölkerung und der übrigen Gesellschaft, zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern und den Verbrauchern.
Unterscheidet sich die Ausbildung eines Bauernpfarrers von der eines Stadtpfarrers? Wie zeitgemäß ist dieser Dienst denn eigentlich noch? Die Zahl der Gläubigen, vor allem der Bauern, ist doch stark rückläufig.
Willi Mönikheim: Zu Ihrer ersten Frage: Nein, es gibt da keinen Unterschied in der Ausbildung. Was bei den meisten Bauernpfarrern jedoch hinzukommt, sind persönliche Beziehungen und praktische Erfahrungen im Bereich der Landwirtschaft. Ich z.B. bin als Bauernsohn aufgewachsen und habe die Landwirtschaft von der Pike auf, also mit Fachschule, Fachausbildung und Gehilfenprüfung etc. gelernt. Ich habe schließlich, weil das damals so üblich war, den Hof meiner Eltern übernommen.
Ein Jahrzehnt später wurde ich dann allerdings mit den Umstrukturierungsmaßnahmen und Planspielen der EG konfrontiert. Die wirtschaftlichen Aspekte wurden zunehmend dominanter, während das Verwalten, Schützen und Behüten, also das traditionelle Selbstverständnis der Bauern, mehr und mehr verblasste. Durch den von der EG eingeleiteten Strukturwandel gerieten die kleinen Bauernhöfe allmählich unter die Räder, so daß Landwirtschaftsflächen mit 15 oder 20 Hektar bald schon nicht mehr überlebensfähig waren.
Meine Frau und ich hatten damals einen Legehennenbetrieb mit ca. 1500 Tieren. Im Sog des Trends nach immer größeren Betrieben stellten wir uns aber bald schon die Frage, ob wir diesen Teufelskreis weiter befeuern und noch einmal Hunderttausende Mark inklusive dem dazugehörigen Schuldendienst auf uns nehmen wollten, um – der eigenen Überzeugung zuwiderlaufend – zu expandieren. Da überleben ja letztlich nur diejenigen, die immer weiter vergrößern, um noch billiger zu produzieren. Für uns war das schlußendlich kein gangbarer Weg, und deshalb haben wir den Hof schweren Herzens aufgegeben. Daß ich als Theologe und später als Bauernpfarrer dem ländlichen Leben dennoch treu bleiben konnte, empfand ich als großes Glück.
Für mich war damals schon abzusehen, daß der Trend zu immer größeren Höfen nicht einer existenziellen Notwendigkeit, sondern unserem profitorientierten System geschuldet ist. Letztendlich können Landwirte diesem Druck nur dann gerecht werden, wenn sie Qualitätseinbußen in Kauf nehmen und ethische Werte opfern! Damit läuft aber der Bauer, der wie kein anderer im Dienste der Schöpfung steht, die er „um Gottes Willen“ erhalten und bewahren soll, Gefahr, sein Selbstverständnis, seine Wurzeln zu verlieren! Das ist ein zweifacher Verlust; ein individueller und gesellschaftlicher! Das beantwortet auch Ihre Frage nach der Notwendigkeit des Bauernpfarrers. Massenproduktion und der Druck durch die abwärtsführende Preisspirale verändern das Ethos des Landwirts. Diese ungute Entwicklung hat meiner Ansicht nach auch einen negativen Einfluß auf unsere gesellschaftlichen Werte! Wir wollen dem Bauern deshalb zur Seite stehen, damit er dem biblischen Auftrag entsprechend als „Arbeiter zwischen Himmel und Erde“ wirken kann.
In diesem Sinn versucht auch die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall sich dem Trend von „Wachsen oder Weichen“ „Fressen oder Gefressenwerden“ zu entziehen und wieder Zeit, Liebe und Engagement als Alleinstellungsmerkmal zu etablieren, sprich, der Qualität den ihr gebührenden Platz einzuräumen. Es gibt, wie man am Erfolg der BESH sehen kann, sehr wohl Menschen, denen das Wie wichtiger ist, als das Wie-viel.
Was mich am Bauerntag zu Lichtmeß angesprochen hat, war die Tatsache, daß Sie Ihre Andacht in Hohenloher Mundart gehalten haben. Das haben Sie während Ihres aktiven Pfarrdienstes wohl immer so gehandhabt. Wie kam es dazu, und was bezwecken Sie damit eigentlich?
Willi Mönikheim: Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bad Mergentheim aufgewachsen. „Hohenlohisch“ ist also zuerst einmal meine Muttersprache. Natürlich habe ich als angehender Pfarrer versucht, mir diese Sprechweise abzugewöhnen, und das hat zu Beginn meines Pfarrdienstes auch ohne große Probleme geklappt. Ich habe also noch nicht versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Der Wendepunkt kam viel mehr bei einer von mir organisierten Israel-Wanderreise, die uns „Auf den Spuren der Bibel durchs Heilige Land“ führte. Während dieser Reise wurde mir zum ersten Mal klar, wie sehr Jesus das ländliche Leben in seinen Gleichnissen thematisiert hat! Die meisten wissen zwar, daß Jesus ein Wanderprediger war, weniger klar ist aber, daß er im ländlich geprägten Galiläa aufgewachsen ist und Gleichnisse aus diesem Umfeld benutzte, die er der heimischen Bevölkerung oftmals auch im heimischen Dialekt erzählt hat.
Während des Studiums fiel mir schon auf, daß große Teile des Alten, wie des Neuen Testaments einen dialektbehafteten Charakter aufweisen. Viele Geschichten haben ihre Wurzeln in ländlich geprägter Kultur, in Ackerbau und Viehhaltung, im Umgang mit Lebensmitteln und den Folgen der Witterung. Es ist ziemlich sicher, daß Jesus, als er mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs war, auch den heimischen galiläisch-aramäischen Dialekt gesprochen hat. Das Hochhebräisch hingegen war damals im Volk gar nicht etabliert, weil es, wie später Latein in der katholischen Kirche, inzwischen eine Kultsprache geworden war. Wenn man zudem noch berücksichtigt, daß die Geschäftssprache zu Zeit Jesu griechisch war und die römischen Besatzer lateinisch gesprochen haben, so wird klar: Dialekt war im Grunde das einzige, was den einfachen Menschen zu jener Zeit ein Gefühl von Heimat und Vertrautheit vermittelte.
Ich erinnere mich, wie ich während der besagten Reise gerade beim Hirtenfeld von Bethlehem saß, als mir plötzlich der Gedanke kam, daß einfache Menschen, wie die Hirten, die Botschaft der Engel überhaupt nicht verstanden hätten, wenn sie diese in einer der gängigen Hochsprachen zu hören bekommen hätten! Dieser eindringliche Moment am Hirtenfeld war für mich der entscheidende Anstoß für den Entschluß, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium beim nächsten Weihnachtsfest in meinen eigenen Dialekt zu übertragen und auf „Hohenlohisch“ zu lesen.
Und wie war die Resonanz in der Dorfkirche? Fackeln und Heugabeln?
Willi Mönikheim: (lacht) Nein, ganz und gar nicht! Klar, für Dialektfremde war diese Erfahrung natürlich zunächst einmal sehr gewöhnungsbedürftig. Doch die meisten Gottesdienstbesucher waren beeindruckt und begeistert. Einige sagten sogar, sie hätten sich mitten in das heilige Geschehen versetzt gefühlt! Das hat mich sehr berührt und bestärkt, damit weiterzumachen.
Wichtig war mir dabei, daß ich den biblischen Text in das Denken und Fühlen der Hohenloher übersetzt und damit quasi in deren regionale Bildwelt überführt habe. Hohenlohisch muß man sich hierbei tatsächlich wie eine eigenständige Sprache mit unterschiedlichem Satzbau, vielen eigenen Begriffen und Metaphern usw. vorstellen.
Eine alte Frau werde ich dabei nie vergessen. Diese Dame kam nach einer Mundart-Andacht auf mich zu und sagte: „I glab, dr Herrgott kou a Hohelohisch!“ Für diese Frau brachte die Art des Gottesdienstes im hohen Alter noch die befreiende Erkenntnis, daß der Schöpfer wohl doch kein Problem damit hat, wenn die innere Zwiesprache auf Hohenlohisch stattfindet! Letztlich kommt es doch, wenn man sich nach „oben“ richtet, immer auf die innere Haltung an und nicht so sehr auf besonders gewählte Worte. Nicht zuletzt wegen dieser Begegnung habe ich wenig später begonnen, regelmäßig Mundart-Hörstücke mit dem Titel „Dr Herrgott kou a Hohelohisch!“ zu veröffentlichen. „Kou“ also „kann“ bedeutet in diesem Zusammenhang, daß der Herr wohl sicher Hohenlohisch versteht, aber nicht unbedingt, daß er es selbst spricht (lacht)!
Wenn Sie die Hohenloher Region wie einen Menschen umschreiben müßten, was für ein Typ wäre diese Gegend?
Willi Mönikheim: Schwer zu sagen. Typisch für die Gegend ist, daß sie als kleines, noch dazu unter vielen verschiedenen Herrschaftsfamilien aufgeteiltes Fürstentum, immer darauf angewiesen war, in gedeihlicher Beziehung zu den unterschiedlichsten Gruppierungen zu stehen. Wenn Fürsten- oder Grafentöchter z.B. irgendwo einheirateten, haben sie als Mitgift meist ein Dorf und dessen Steuereinnahmen bekommen. So wechselte die Herrschaft eines Dorfes, manchmal sogar eines Ortsteiles, des Öfteren. Man mußte also immer schon mit wechselnden Gepflogenheiten zurechtkommen. Das hat die Mentalität dieser Gegend ein Stück weit mitgeprägt. Vielleicht versucht der typische Hohenloher deswegen freundlich und offenherzig zu sein und mit allen Menschen gut auszukommen. Es wäre allerdings falsch zu glauben, er sei deswegen auch immer gleich mit allen gut Freund. Der Hohenloher braucht schon eine Weile, bis er auftaut und sich vertrauensvoll öffnet.
Man sagt auch, daß die Hohenloher „schlitzohrig“ wären, also ein Talent hätten, gut durchzukommen. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die „Uneigentliche Rede“. Da entschärft man konfliktbehaftete Themen, indem man sie indirekt und humorvoll, „durch die Blume“ anspricht. Da ist z.B. eine Bäuerin, die Feriengäste beherbergt; eine Familie aus Schwaben und eine aus Hohenlohe. Beide Parteien sitzen beim Frühstück auf der Terrasse. An diesem Tag fehlt aber leider das allmorgendliche Ei aus dem hiesigen Hühnerstall und zwar, weil es die Bäuerin offensichtlich vergessen hat. Der Gast aus Schwaben sagt hierauf: „Bäuere! Sie hend unsere Euer vergesse!“ (Sie haben unsere Eier vergessen!). Der Gast aus Hohenlohe sagt hingegen: „Leiichee deii Hähner nimme, weil s haid ko Gaggele gibd?“ (Legen deine Hühner nicht mehr, weil es heute keine Eier gibt?). Der Hohenloher sagt zwar alles, was ihm wichtig ist, aber auf eine Weise, die nicht beschuldigt und dem anderen die Würde läßt. Der erste, unverblümte Satz bedeutet hingegen so viel wie „Du bist eine schlechte Gastgeberin!“.
Eine typisch hohenlohische Redensart, die diesen Stil ebenfalls gut darstellt, lautet: „I soch nedd sou und soch nedd sou. No kou donoch au koner soche, i hädd sou gsochd oder sou! Ond des werd mer ja noch sooche däffe!“. Ich sag nicht so und ich sage nicht so. Dann kann später keiner sagen, ich hätte es so oder so gesagt! Und das wird man wohl noch sagen dürfen!“
Die umfangreiche Systemkritik in Ihrer Andacht beim Bauerntag darf ja eigentlich vor verkrusteten Kirchenstrukturen nicht Halt machen. Können Sie verstehen, daß die Kirche mit ihrer Deutungshoheit der Bibel in vielen Punkten versagt hat, z.B. indem sie klerikales Menschenwollen in Gotteswillen ummünzte und dadurch Machtmißbrauch betrieb?
Willi Mönikheim: Natürlich verstehe ich das. Im 500. Gedächtnisjahr der Reformation sowieso! Alle menschlichen Zusammenschlüsse, insbesondere die kirchlichen, haben einen kritischen Diskurs notwendig. Sie müssen dauerhaft reformfähig bleiben, wandlungsfähig, wie die Schöpfung selbst! Sobald politische, religiöse, aber auch wirtschaftliche Gruppierungen anfangen sich abzugrenzen, mutieren an sich gute, zeitlose Ziele zu starren, unmenschlichen Standpunkten, die weder dem Menschen noch dem Leben guttun. Dann kann es, im wahrsten Sinne des Wortes, „lebensgefährdend“ werden!
Man wirft der Kirche heutzutage aber auch allzu schnell Versagen vor und prangert sie nur zu gerne an. Auf der einen Seite hat sich die Kirche, wie schon erwähnt, tatsächlich viel zu Schulden kommen lassen und diesen Vorwurf irgendwo auch „verdient“. Es gab Machtmißbrauch und Mißbrauch des Amtes zu eher irdischen Zwecken. Andererseits möchte ich von meiner Warte aus auch sagen, daß es bei den Geistlichen eben auch menschelt. Wir sind ein repräsentativer Teil der Gesellschaft. Wir sind weder Heilige mit eingebautem Sonderstatus, noch Menschen mit übernatürlichen Kräften. Unser Selbstverständnis sollte schlicht in der liebevollen Sensibilisierung für das Leben liegen, das wir Gott verdanken! Nicht mehr, nicht weniger!
Ich bin sehr dankbar, daß ich meine Kirche habe. Sie ermöglicht es, daß Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen sich austauschen und gegenseitig verstehen lernen können.
Wie paßt denn gelebter Glaube überhaupt zu einem formellen, theologischen Rahmen?
Willi Mönikheim: Die Kirche kann mir Entscheidungshilfen an die Hand geben, um außerhalb des religiös-kultischen Rahmens Gott gemäß zu leben und seinem Willen entsprechend handeln zu können! Man muß sich aber schon auch klarmachen, daß der Raum, in dem das gesellschaftliche Leben stattfindet, nicht die Kirche ist und Glaube erst in Eigenverantwortung lebendig werden kann! Die Gemeinde ist hierbei eine Plattform des Glaubens. Die Kirche kann nur vorbereitende Schule für den Lebensalltag sein – ein Alltag, der geistlich und geistig veredelt werden kann und soll. So gesehen bedarf ein gelebter christlicher Glaube, der sich auf Kult, Offenbarung oder Schöpfungswerk bezieht, zum einen immer der Orientierung an den Grundsätzen der Kirche und Gemeinde, zum anderen aber auch der Eigenverantwortung des Individuums. Ein derart gelebter Glaube kann die Grundlage für jegliche Art guter Beziehungen sein.
In Ihrer Andacht thematisieren Sie den Turmbau zu Babel und bringen ihn mit zeitaktuellem Geschehen in Verbindung. Wie kann uns dieses biblische Gleichnis heute helfen?
Willi Mönikheim: Wichtig ist zu verstehen, daß die Geschichten aus der Bibel oder aus einem anderen Offenbarungsbuch in erster Linie Lehrgeschichten sind! Sie sollen den menschlichen Geist ansprechen und anregen. Diese „Urgeschichten“ werden entwertet, wenn man versucht sie in der Gegenwart zu verorten. Wenn ich die Geschichten der Bibel oder eines anderen heiligen Buches theologisch verenge und Sätze herauspicke, um in einem religiösen Konkurrenzkampf die Oberhand zu gewinnen, wird es schwer, die dahinterliegenden Werte zu erkennen. Wenn ich das ganze Schöpfungswirken jedoch als Ordnung der Liebe verstehe, die Lebenshilfe bieten will, dann können derlei Bücher beleben und Orientierung geben!
Oftmals haben diese Geschichten jedoch einen historischen Kern und knüpfen an belegbare Ereignisse an. Es gab zu besagter Zeit tatsächlich turmartige Zirkularbauten in Babylon. Diese Sakralbauten wurden mit einer langen, aufwärtsführenden Treppe versehen, wobei sich oben immer der Platz befand, wo sich Himmel und Erde begegnen, wo der Priester, als Vertreter des Volkes, dem verehrten Gott Opfer darbringt und dafür Gottes Zuwendung und Weisung empfängt, die er wiederum dem Volk vermittelt. Der berühmte Turmbau aus der biblischen Geschichte, der als Grundlage meiner Andacht diente, sollte aber – nach dem Wunsch seiner Erbauer – immer höher werden und bis zum Himmel reichen, was letztlich bedeutet, daß der Mensch sich selbst an Gottes Stelle setzen will.
Die Babylonische Turmbaugeschichte ist für mich als Bauernpfarrer interessant, weil sie typisch für die kulturgeschichtliche Entwicklung im Euphrat- und Tigrisgebiet ist. Sie markiert in anschaulicher Weise den Übergang von Landkultur zur Stadtkultur. Archäologen fanden in diesem Gebiet uralte Steinkreise. Diese Kultstätten und die dort angebeteten Götter sollten die Landbevölkerung und ihre für die Seßhaftwerdung lebensnotwendigen Feldfrüchte und Obstbestände beschützen. Im Laufe der Zeit entstanden dann in der Umgebung die ersten großen Siedlungen. Diese Städte wurden abgesichert und ummauert und lebten in Folge nicht mehr von der Landwirtschaft, sondern vom Handel. Wenn Sie so wollen, waren das die ersten Merkmale der Industrialisierung wichtiger Lebensbereiche, weg vom „spirituellen“ Grundsatz des „Lebens-Mittels“, hin zur anonymisierten „Handels-Ware“, die dem Profit dient.
Ein interessanter Aspekt der Geschichte ist ebenfalls, daß sich im Zuge des Turmbaus die Menschen plötzlich nicht mehr verstehen können und zwar höchstwahrscheinlich weniger sprachlich, sondern in ihren Ansichten, in ihren Zielen! Der Wohlstand, der Schutz durch die Mauer, die großen stabilen Häuser, die scheinbare Unabhängigkeit von der Landarbeit, all das führt zur Hybris, gottgleich zu sein. Steht denn bei den technischen Errungenschaften heute nicht auch oft die Allmachtsphantasie im Vordergrund, die Vorstellung, man könne seine persönlichen Pläne und Wünsche ohne Rücksicht auf andere Menschen, ohne Gottes Hilfe realisieren? So eine Einstellung befeuert die Eitelkeit des Menschen, geistiges Strebertum, Konkurrenzkampf und Ausbeutungstendenzen. Vor allem führt solch ein Weg in die Sackgasse, weil das darin fehlende Verantwortungsbewußtsein einer sinnvollen Entwicklung im Wege steht.
In der Frage, ob der Mensch alles darf, was er kann, stellt sich die Frage nach der Ethik. Welche Bedeutung hat für Sie in diesem Zusammenhang der Bibelausspruch: Macht euch die Erde untertan? Benötigen wir eine neue Wertedebatte, eine „Ökonomische Leitkultur“, und welchen Beitrag kann die Bibel dazu leisten?
Willi Mönikheim: Es ist durchaus in Ordnung, wenn man ein ödes oder verwildertes Stück Land urbar macht und für seine Zwecke kultiviert. Im Idealfall profitieren ja Mensch und Natur davon. Schlimm wird es, wenn man aus Profitgier handelt und versucht, das Land ohne Rücksicht auf Bodenleben und Pflanzenwohl für den eigenen Vorteil auszulaugen und wie „Dreck“ zu behandeln.
Natürlich sollen wir uns die Erde „untertan“ machen, anders wäre ein Überleben unserer Spezies gar nicht möglich. Gemeint ist aber ein verantwortungsbewußtes Kultivieren des Landes als guter Verwalter. Die Bibel ist da eindeutig: Was Gott gut geschaffen hat, soll der Mensch im Sinn des Schöpfers bebauen, pflegen und bewahren – nicht ausbeuten und auslaugen, bis der Boden seine Fruchtbarkeit verliert.
Das Ganze bekommt einen völlig anderen Stellenwert, wenn man die Natur nicht als Gegner ansieht, als Steigbügel für das eigene Ego, sondern als Partner! In den biblischen Urgeschichten wird genau deswegen immer wieder betont, daß wir Menschen alle miteinander verwandt sind! Dieser Hinweis zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, von Adam und Eva bis hin ins Neue Testament, wo uns erlaubt wird, Gott „Abba“ (lieber Vater) zu nennen. An einen Schöpfer zu glauben, bedingt im biblischen Sinne also auch, daß wir Menschen uns als Brüder und Schwestern, als Kinder des Schöpfers betrachten.
In einem älteren Schöpfungsbericht, wie er im zweiten Kapitel der Bibel überliefert ist, wird erzählt, daß Gott Erde vom Ackerboden nahm und daraus den ersten Menschen formte. Diese Erde heißt auf Hebräisch „Adama“. Der aus ihr geformte Mensch wird „Adam“ genannt. Dieses Wortspiel macht schon deutlich, daß der Mensch „ein Kind der Erde“ ist. Danach bläst Gott dem noch leblosen Erdengeschöpf seinen Ruach (Geist, Atem) in die Nase – „und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“! Wir sind so betrachtet einerseits „Kinder der Erde“, andererseits sind wir auch Kinder des Himmels, also des Schöpfers, dem wir unser Leben verdanken. Wir sind Bürger zweier Welten, sind somit Mutter Erde und dem Vater im Himmel gleichsam zum Dank verpflichtet! Wenn wir in diesem Bewußtsein unser Dasein verstehen und gestalten, dann haben wir die Chance, das Leben in dieser Welt, auf unserer Erde, besser, natur- und menschenfreundlicher mitzugestalten.
Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Willi Mönikheim: Da kann ich nur aus meiner Andacht auf dem Hohenloher Bauerntag zitieren: „Eine stabile, auf Nachhaltigkeit angelegte Entwicklung darf nicht nur fragen, „was mir etwas bringt“ und „wie viel ich dabei verdiene“. Da muß auch gefragt werden, wie die Auswirkungen für die betroffenen Menschen und Völker sind, für das Klima, die Natur und Umwelt – und auch für die Kultur und Religion. Auf so einem Boden wachsen nicht nur gute Beziehungen, auf so einem Boden läßt sich am besten „Miteinander Zukunft gestalten“. Wichtig ist da vor allem, daß man immer daran denkt, was gut für das Zusammenleben im Kleinen und Großen ist: Mehr miteinander als gegeneinander. Traditionen bewahren, aber auch aufgeschlossen sein für neue Ideen. Weniger Konkurrenz und mehr Einsatz für die Zusammengehörigkeit. Weniger Tratsch übereinander und mehr gute Gespräche miteinander. Weniger Mißtrauen und mehr Vertrauen, weniger Tadel und mehr Respekt vor dem, was andere denken, sagen, glauben und tun. Weniger Gedankenlosigkeit im Umgang mit unseren Lebensmitteln und mehr Anerkennung für diejenigen, die mit dafür sorgen, daß wir jeden Tag ein gutes, nahrhaftes Essen frisch auf unserem Tisch haben. Das ist der Boden, auf dem der Segen Gottes Wurzeln schlagen und sich gut entwickeln kann.